Krisen legen Schwächen offen, bieten aber auch die Chance, über den eigenen Schatten zu springen und Neues zu wagen. Die Ukrainekrise erfüllt bisher die erste Funktion. Sie entblößt rücksichtslos die Schwächen der europäischen Politik, ihre Widersprüche und Inkonsequenzen. Die Frage, ob diese bittere Erfahrung auch Ansporn sein wird, Europa außenpolitisch handlungsfähig zu machen, bleibt offen. Eins steht fest: Wenn die Chance jetzt nicht genutzt wird, kann man eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheits-, aber auch Verteidigungspolitik für lange Zeit vergessen.
Das gewaltige geopolitische Konfliktpotenzial östlich der EU und der NATO ist wohl jedem Sicherheitspolitiker seit geraumer Zeit bewusst gewesen. Die meisten haben einfach gehofft, dass es sich nicht entfalten würde. Um das zu verhindern, wurde mühevoll versucht, Russland in ein enges Kooperationsnetz einzubinden. Es sollte die Energie des Landes in produktive Bahnen lenken und seine Führung von aggressiven Absichten abbringen. Zugleich wurde der Ukraine und einigen anderen Ländern, nicht ohne Zögern, eine EU-Anbindung in Aussicht gestellt. Das geschah auch in der Hoffnung, dies würde Reformanstrengungen ermutigen und dadurch einen demokratischen und marktwirtschaftlichen Wandel der Region ermöglichen. Soweit sie an Russland adressiert war, ist diese Politik gescheitert. Die Annexion der Krim und der folgende unerklärte Krieg gegen die Ukraine haben daran keinen Zweifel gelassen. Psychotherapeutische Ansätze wie „Was haben wir falsch gemacht?" oder „Haben wir Russland unnötig provoziert?" sind nur ziemlich peinliche Versuche, von der unangenehmen Einsicht des Scheiterns abzulenken.
Jeder Ansatz einer wirklich anderen Politik muss davon ausgehen, dass die bisherige ihre Grenzen erreicht hat.
Jeder Ansatz einer wirklich anderen Politik muss davon ausgehen, dass die bisherige ihre Grenzen erreicht hat. Dies zu leugnen käme demselben Fehler gleich, den manche westdeutschen Politiker machten, als in Polen im Dezember 1981 das Kriegsrecht verhängt wurde und die einst erfolgreiche Entspannungspolitik an ihre Grenzen stieß. Doch erforderlich ist zugleich auch eine andere Grundeinsicht: nämlich die, dass Russland auch weiterhin unser Nachbar bleiben wird. Deshalb haben wir ein fundamentales Interesse daran, die Beziehungen zu Russland vernünftig zu regeln.
Derzeit gibt kaum etwas Anlass zu der Hoffnung, dass sich die innere Verfassung Russlands ändern und sich das Land auf den Westen zubewegen wird. Deshalb brauchen wir in der Russlandpolitik eine realistische Strategie. Wenn der Begriff nicht so oft als Inbegriff des egoistischen Machtzynismus missbraucht worden wäre, könnte man diese durchaus als realpolitisch bezeichnen.
Unüberbrückbare Gegensätze hinsichtlich europäischer Ordnungsvorstellungen
Dieser politische Realismus führt zur Erkenntnis, dass zwischen Europa und Russland heute und auf längere Zeit unüberbrückbare Gegensätze hinsichtlich europäischer Ordnungsvorstellungen bestehen werden. Russland hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es die atlantische und europäische Integration für eine unbegründete Abweichung von der Tradition der nationalstaatlichen Machtpolitik hält. Es war ein Irrtum anzunehmen, dass Moskau diese Strukturen nur deshalb ablehnte, weil es in ihnen keinen Platz für sich selbst ausmachen konnte. Die Ablehnung ist grundsätzlicherer Natur. Russland ist nicht bereit, seine Handlungsfreiheit durch bindende Normen einzuschränken. Selbst die OSZE geriet in russische Kritik, als sie sich darum bemühte, ihren Auftrag in von Russland beanspruchten Gebieten zu erfüllen.
Dieser Gegensatz lässt sich nicht als ideologischer Streit ohne praktische Konsequenzen abtun. Spätestens der Krieg gegen die Ukraine hat ihn auf die Ebene politischer Grundsatzentscheidungen übertragen. Der Zwang, eine Antwort auf die russische Aggression zu formulieren, wurde zu einem bestimmenden Moment europäischer Politik. Das gilt zunächst für die Innenpolitik vieler Mitgliedstaaten, in denen alte und neue EU-Gegner von rechts und links sich ermutigt fühlten, ihre Verachtung für das liberale Europa offen auszusprechen. Das gilt aber auch für die Außenpolitik, in der sich die Tendenz gezeigt hat, alten nationalen Handlungsmustern anstatt den relativ neuen europäischen Loyalitäten zu folgen.
Polens Bedürfnis nach Rückversicherung aus dem Westen
So zerbrach, zur Überraschung vieler und Enttäuschung mancher, die oft beschworene Gemeinschaft der neuen EU-Mitglieder. Die vorkommunistische Geschichte erwies sich als prägender als die gemeinsame Ostblockvergangenheit. So gingen Ungarn oder die Slowakei in der Russlandpolitik einen anderen Weg als Polen und die baltischen Staaten.
Aus polnischer Perspektive ist das schmerzhaft. Entscheidend bleibt für Polen, aber unter umgekehrten Vorzeichen auch für Russland, die Frage, wie Deutschland auf den osteuropäischen Machtkonflikt reagiert.
Der Ukrainekrieg hat auch in Deutschland alte, überwunden geglaubte Denkmuster aktiviert, deren Anhänger allerdings oft gar nicht wissen, welche historischen Traditionen ihr Handeln und Denken bestimmen. Der Streit um die richtige Antwort auf den Krieg wird so zu einer Grundsatzdebatte über die Ausrichtung der deutschen Politik, über die Zukunft der Westbindung, über das Verhältnis zwischen nationalen Interessen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen, über den Sinn der gewachsenen Verantwortung und Macht Deutschlands. Diese Diskussion wird in Polen mit Spannung und manchmal auch Skepsis verfolgt.
Es ist schwer zu verstehen, weshalb sich Berlin und Paris entschlossen, in die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine ohne Polen einzutreten.
Für Polen ist Deutschland der zentrale Bezugspunkt in der außen- und sicherheitspolitischen Orientierung. Ähnlich, aber viel elementarer als für Frankreich. Während im französischen Denken die Sorge um den eigenen Status in der internationalen Politik eine große Rolle spielt, geht es im polnischen Fall um grundsätzliche geopolitische Interessen. Mit dem wachsenden Druck vom Osten steigt auch das Bedürfnis nach Rückversicherung aus dem Westen. Diese kann nicht nur aus Amerika kommen. So wichtig die atlantische Solidarität angesichts der Krise ist, den größten Teil der Verantwortung müssen die Europäer selbst übernehmen. Drei Ländern kommt dabei eine besondere Rolle zu: Deutschland, Frankreich und Polen. Sie haben die historische Erfahrung, um das Konfliktpotenzial in Osteuropa zu verstehen. Und sie haben, wenn auch in unterschiedlichem Maße, die Macht, um eine gemeinsame europäische und atlantische Antwort auf die Herausforderungen in Osteuropa zustande zu bringen. Dieses sogenannte Weimarer Dreieck, dessen Vielfalt eine Stärke ist, hat in der Anfangsphase des Ukrainekonfliktes eine positive Funktion erfüllt. Es ist schwer zu verstehen, weshalb sich Berlin und Paris entschlossen, in die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine ohne Polen einzutreten. Dies ist keine Prestigefrage. Ohne Polen ist die europäische Vertretung weniger repräsentativ und nicht erfolgreicher geworden. Und an Moskau wurde ein falsches Signal ausgesandt.
Die schwache Beteiligung der europäischen Institutionen am Krisenmanagement scheint niemanden besonders zu überraschen. Sie ist trotzdem ein Handicap der europäischen Politik. Ambitionierte Mitgliedstaaten werden ohne Zweifel die erste Geige spielen. Sie geben sich aber bisher selbst den Auftrag zum Handeln. Die europäischen Institutionen spielen dabei eine geringe Rolle. Das könnte sich ändern. Der Anspruch von Ländern wie Deutschland, Frankreich, aber auch Polen, im Namen der EU zu handeln, würde auf diese Weise eine zusätzliche Legitimation erhalten.
Der Ukrainekonflikt ist nicht die einzige Krise, die die Europäische Union zum Handeln herausfordert. Auch der Nahe Osten benötigt einen realen Beitrag der EU. Auch ist zu bedenken, dass die innere Krise der EU das europäische Selbstbewusstsein in den vergangenen Jahren stark angeschlagen hat. Doch bei aller Brisanz, die komplexeste Herausforderung an Europa kommt aus dem Osten des Kontinents selbst. Hier sind die Interessen, die Werte und das Selbstverständnis Europas direkt betroffen. Der aktuelle Konflikt um die Ukraine kann Europa auseinander dividieren oder aber handlungsfähiger und selbstbewusster machen. Die Entscheidung, was es wird, werden vor allem die Staaten selbst treffen. Sie brauchen dafür aber keine umfassenden institutionellen Reformen. Sie sollten sich lediglich auf einige Regeln verständigen, die die Effizienz des Handelns mit stärkerer europäischer Legitimität verbinden. Ist das möglich? Viele europäische Staaten machen gerade im Ukrainekonflikt die manchmal demütigende Erfahrung eigener Schwäche. Das bleibt selbst den Mächtigsten nicht erspart. Eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas ist deshalb nicht mehr eine Frage des Ehrgeizes, sondern ein Gebot elementarer politischer Vernunft. In diesen Tagen ist sie sogar ein notwendiger Ausdruck des politischen Überlebensinstinkts.


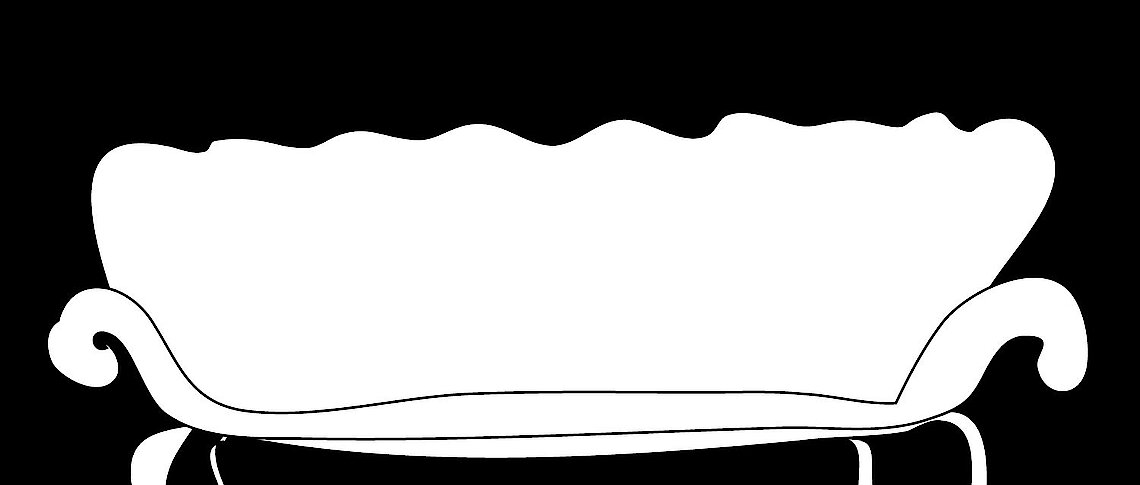




7 Leserbriefe
Und es stimmt nicht, dass der kooperative Ansatz für die Russlandpolitik gescheitert ist. Offensichtlich an ihre Grenzen gestoßen ist allerdings die US-Politik, die gesellschaftspolitischen Verhältnisse in den Ländern, die an Russland grenzen, grundlegend im westlichen Sinn zu verändern und der Versuch, Russland einzudämmen und zu schwächen - das hat der Hauptverfechter dieser Politik Brzezinski inzwischen selbst eingeräumt. Diese Politik ist es, die den kooperativen Ansatz unterlaufen und unglaubwürdig gemacht hat. Weiterhin gilt: Kooperation mit Russland in Europa, so viel wie immer möglich, Einbeziehung Russlands in die Lösung der zahlreichen internationalen, grenzüberschreitenden Probleme und friedlich Koexistenz, wo Kooperation nicht möglich ist und vor allem ein langer Atem auf diesem Weg der "kleinen Schritte". Gerade die (vielfach als Schwäche diskreditierten) immer wieder neuen Anläufe für eine Verhandlungslösung auch in der heißesten Phase des Ukraine-Konflikts (von einer starken westlichen Position aus und als Teil einer Doppel-Strategie) hat uns wohl vor einem Hineinschlittern in eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem Atomwaffenstaat bewahrt.
Der Beitrag von Herrn Reiter zeigt: wir haben im Zusammenwachsen Europas noch einen weiten Weg vor uns und werden da nur weiterkommen, wenn wir es schaffen, einander zuzuhören und zu verstehen, bevor wir (vorgefasste) Urteile übereinander fällen.
Warum hat die EU in der Ukraine Organisationen unterstützt, die ganz klar faschistische Züge zeigen ? Ist das demokratisch ?
Der demokratisch gewähle Präsident wurde auf nicht ganz legale Weise gestürzt, ist das demokratisch ?
Was hat der größte Teil der Bevölkerung der Ukraine von marktwirtschaftlichen Reformen unter Anleitung des IWF, der USA und Deutschlands, die, ähnlich in Griechenland und Spanien angewendet, eine Menge Volks in die Verarmung gestürzt haben ?
Ist es demokratisch, wenn der neue Machthaber einen Teil seiner Bevölkerung gezielt dezimiert und dessen Infrastruktur zerstört - wenn Syriens demokratisch gewählter Staatschef solches tut, wird er zum Buhmann erklärt und die IS aufgerüstet, um Krieg gegen den zu führen.
Machtpolitische Interessen, das können Sie bei Brzezynski nachlesen, bedient die NATO schon seit ihrer Gründung. Oder hat Russland das Gebiet der NATO schon einmal angegriffen ?
Ihr Artikel ist Träumerei und enthält eine üble Verdrehung der Tatsachen - Russlang muss sich durch die NATO bedroht fühlen. Und polnische Bedenken werden seitens der NATO unberücksichtigt bleiben.
Vielleicht gehören Sie ja auf die Couch.