Die aktuelle Diskussion um eine politische Reaktion auf die jüngste Eskalation im Ukraine-Konflikt umfasst nicht zuletzt das Damoklesschwert umfassender Wirtschaftssanktionen. Ob es tatsächlich zu einer dritten Sanktionsstufe der Europäischen Union kommt, ist dabei bislang ebenso unklar wie der Umfang solcher Sanktionen und ihre Auswirkungen. Klar ist hingegen, dass umfassende Sanktionen eine russische Wirtschaft träfen, die kaschiert von Rohstoffexporten und damit zusammenhängenden jahrelangen positiven Wachstumszahlen tatsächlich in einer strukturellen Dauerkrise steckt.
Klar ist, dass umfassende Sanktionen eine russische Wirtschaft träfen, die kaschiert von Rohstoffexporten und damit zusammenhängenden jahrelangen positiven Wachstumszahlen tatsächlich in einer strukturellen Dauerkrise steckt.
In seiner Wahlkampagne vor zwei Jahren hatte Präsident Putin noch mit einer jährlichen Wachstumsrate von fünf Prozent geworben. Doch seitdem purzelten die Jahresprognosen: Von zunächst 3,5 Prozent ging es bald im Monatsrhythmus nach unten. Zum Jahresende 2013 verblieb ein Wachstum von 1,3 Prozent. Im dritten Quartal 2013 kam es dabei je nach Berechnungsgröße zu einer Stagnation oder sogar zu einer Rezession.
Die Botschaft ist eindeutig: Die russische Wirtschaft leidet nicht lediglich an einer konjunkturellen Delle. Mittlerweile bleibt sogar die Frage unbeantwortet, woher selbst das inzwischen niedrig angesetzte Wachstum überhaupt noch kommen soll. Ein Aufholen gegenüber anderen Schwellenländern oder der Weltwirtschaft insgesamt gilt längst als illusorisch.
Breschnew-Zeitalter der Ökonomie?
Auch ungeachtet der Auswirkung möglicher Wirtschaftssanktionen sind die Zukunftsaussichten der russischen Wirtschaft alles andere als rosig. Ein baldiges und anhaltendes Anziehen der Energiepreise ist wenig wahrscheinlich und auch ein Aufschwung der Weltwirtschaft lässt auf sich warten. Dafür verschieben sich die Energiemärkte. Die USA dehnen ihre Schieferölgewinnung aus und dürften Russland voraussichtlich in diesem Jahr als weltgrößten Lieferanten überholen. Zudem baut sich im Iran nach dem Atomabkommen langfristig ein neuer Wettbewerber auf. Russland, an keine OPEC-Quoten gebunden, kann mengenmäßig kaum reagieren. Denn mehr als eine einprozentige Zunahme der Ölförderung pro Jahr ist unrealistisch.
Hinzu kommt: Auf den Gasmärkten sinken die Preise. US-Schiefergas und der weltweite Ausbau der Flüssiggaskapazitäten drücken auf die russischen Gasumsätze. Auch der geplante Einstieg in die Schiefergasförderung dürfte dabei keine Abhilfe schaffen. Russlands Vorkommen sind schwer zu erschließen, und ein Anteil an der nationalen Förderung von mehr als 10 Prozent wird bis 2020 nicht erwartet. Zwar nimmt Moskau Gasverflüssigung zunehmend ernster, so wurden in Südkorea Gastanker in Auftrag gegeben, doch küstennahe Gasvorkommen existieren kaum. Zudem bleiben die Lieferungen an das Röhrennetz gebunden. Der Ausbau des Netzes aber ist teuer und zeitaufwendig. Es dürften Jahre vergehen, bevor Lieferungen in nennenswertem Umfang nach Asien fließen können.
Russlands Wirtschaft steckt in einem Dilemma: Sie hat sich mit der sogenannten holländischen Krankheit infiziert, ohne bislang vollständig erkrankt zu sein. Tatsächlich sind in Russland derzeit die beiden kritischen Symptome erkennbar, die in Ressourcen-Ökonomien bei rapiden Energiepreissteigerungen in der Regel auftreten: Eine starke (Real-)Aufwertung der Währung und eine rückläufige Warenausfuhr vor dem Hintergrund geringerer internationaler Wettbewerbsfähigkeit.
Bemerkenswert ist dabei, dass es Russland weitgehend versäumt hat, im Energie- und Rohstoffbereich Weiterverarbeitungskapazitäten aufzubauen, um seinen Ressourcenvorteil besser zu nutzen. In den zu Sowjetzeiten stark geförderten Sektoren Maschinenbau, Ausrüstungsgüter und Fahrzeugbau sind die Exportmärkte weitgehend weggebrochen. Doch auch in der Weiterverarbeitung eigener Rohstoffe kommen nur wenige neue Sektoren hinzu. In Sachen Außenhandelsprofil setzt Russland letztlich auf eine koloniale Arbeitsteilung: Weg von der Industrielastigkeit der Sowjetunion und hin zur Ausfuhr weithin unverarbeiteter Rohstoffe. Der Blick auf die Importliste gibt die Kehrseite frei: Eingeführt werden überwiegend Güter mit langen und technologielastigen Wertschöpfungsketten.
Zwar ist eine russische Industriepolitik durchaus vorhanden, sie lässt sich jedoch vor allem in den Bereichen Energie, Waffentechnik, Raumfahrt und Flugzeugbau sowie Fahrzeugbau verorten. Dabei kann diese Politik nicht darüber hinwegtäuschen, dass Russland zwei Jahrzehnte Industriepolitik verschlafen hat. Erst jetzt scheint die Frage nach einer Re-Industrialisierung und ökonomischen Umstrukturierung ernsthaft gestellt zu werden. Ein ausgearbeiteter Plan, welche Branchen und Produktsegmente darunter fallen und welche Instrumente zum Einsatz kommen sollen, liegt jedoch nicht vor.
Um hierbei erfolgreich zu sein, wären elementare Reformen notwendig: Eine Abwertung des Rubels zur Verbesserung der Wettbewerbschancen, ein besserer Investitions- und Eigentumsschutz sowie freier Marktzugang für Unternehmen. Ein Wettbewerbsrecht, das diesen Namen verdient, hat Russland jedoch nicht. Und in vielen Regionen (und zum Teil landesweit) sind Marktzugänge politisch geschützten Privatunternehmen vorbehalten.
Eine wirkliche Trennung von Staat und Wirtschaft strebt der Kreml dabei auch gar nicht an. Die gegenseitige Durchdringung von Staat und Wirtschaft, Patronage und Klientelismus wären in Frage gestellt...
Eine wirkliche Trennung von Staat und Wirtschaft strebt der Kreml dabei auch gar nicht an. Die gegenseitige Durchdringung von Staat und Wirtschaft, Patronage und Klientelismus wären in Frage gestellt. Die jüngste Reform des Gerichtswesens mit der Auflösung der unabhängigen Arbitragegerichte und deren Integration in die allgemeine Gerichtsbarkeit sind Signale, dass die politische Knebelung von Unternehmen fortbestehen soll. Enttäuschend fiel auch die lange diskutierte Unternehmeramnestie im Dezember 2013 aus. Von den über 10 000 Unternehmern, die unter fragwürdigen Vorwürfen in Haft sind, kamen nur 1408 auf freien Fuß. Das zeigt: In Russland sind derzeit weder Eigentumsrechte noch die persönliche Sicherheit der Unternehmer garantiert – mit entsprechender Belastung des Investitionsklimas.
Diese Krise der Industrie zeigt sich in der Beschäftigungsquote. So schrumpfte die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe zwischen 1990 und 2012 um volle 10 Mio. Ein solcher Rückgang ist nichts weniger als eine starke Tendenz der De-Industrialisierung. Allerdings hat sich das Tempo des Arbeitsplatzabbaus über die Jahre deutlich verlangsamt.
Putins Haushaltspolitik: Kürzungen bei Bildung und Gesundheit, erhöhte Militärausgaben
Wachstumstreiber der letzten Jahre waren neben Energieeinnahmen vor allem die Konsumausgaben. Doch auch diese werden diese Rolle künftig kaum mehr spielen können. Schon 2013 warnte die Zentralbank vor einer Kreditblase. Inzwischen verschärfte sie die Auflagen für Konsumentenkredite, und Großbanken stockten ihre Rücklagen für Kreditausfälle auf. Ein schuldengetriebenes Konsumwachstum dürfte daher ausbleiben.
Doch ebenso wenig kann nun mit einer expansiven staatlichen Haushaltspolitik gerechnet werden. Russland hat von 2000 bis 2011mit Hilfe reichlich geflossener Öleinnahmen eine klassische Haushaltskonsolidierung betrieben. Die staatlichen Auslandsschulden der Jelzin-Regierung wurden zurückgezahlt, der Haushalt im Gleichgewicht gehalten. Auch der amtierende Finanzminister Siluanov behält bisher die konservative Konsolidierungspolitik bei. Mit den weniger sprudelnden Einnahmen werden nun jedoch auch die Ausgaben gekappt.
Im Haushalt für die Jahre 2014 bis 2016 sind fast alle Bereiche von Einsparungen betroffen, nicht aber die Militärausgaben. Putins großes Reformprojekt der Armeemodernisierung erhält weiter reale Zuwächse. Eingespart wird dagegen bei den Bildungs- und Gesundheitsausgaben.
Russische Finanzmärkte im freien Fall
Zur Jahresmitte 2013 wechselte Elwira Nabiullina in die Führung der Zentralbank. Mit der ehemaligen Wirtschaftsministerin erhofften sich Anhänger einer lockeren Geldpolitik vor allem eine Senkung der Zinsen. Zunächst blieb der Leitzins unverändert. Dennoch kündigte Nabiullina einen Paradigmenwechsel an: Die Zentralbank soll nun vorrangig Inflationsbekämpfung betreiben. Die Wechselkurse dürfen sich stärker anpassen, zum Jahresbeginn 2015 soll der Wechselkurs gar frei sein. Seither sinkt die Währung. Von Anfang 2013 bis Februar 2014 verlor der Rubel gegenüber dem US-Dollar und dem Euro jeweils rund 20 Prozent. Das entspricht einer Realabwertung von etwa 14 Prozent. Doch dabei ist es nicht geblieben.
Als der Föderationsrat am 1. März den Einsatz russischer Truppen in der Ukraine „bis zur Normalisierung der gesellschaftspolitischen Lage“ genehmigte, gerieten die Finanzmärkte Russlands in Panik. Mit dem Ansturm der Kundschaft auf die Wechselstuben sank der Rubel-Kurs innerhalb von Stunden um 4 bis 5 Prozent. An manchen Orten wurden Knappheitsprämien von 25 Prozent gemeldet. Die Zentralbank warf 10 Mrd. US-Dollar ihrer Devisenreserven auf den Markt und hob den zentralen Leitzins um 150 Basispunkte auf 7 Prozent an.
Als der Föderationsrat am 1. März den Einsatz russischer Truppen in der Ukraine „bis zur Normalisierung der gesellschaftspolitischen Lage“ genehmigte, gerieten die Finanzmärkte Russlands in Panik.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist unabsehbar, welche ökonomischen Auswirkungen eine weitere politische Eskalation der Ukraine-Krise haben würde und wie dies die Außenwirtschaftsbeziehungen Russlands beeinflussen würde. Klar ist jedoch, dass Wirtschaftssanktionen des Westens ein weitgehendes Ausbleiben ausländischer Direktinvestitionen zur Folge hätte. Die Kapitalflucht aus Russland könnte dann bedrohliche Ausmaße annehmen. Schon im vergangenen Jahr belief sich der Kapitalexport auf 62,7 Mrd. US-Dollar. Allein für Januar 2014 wurden 17 Mrd. US-Dollar gemeldet.
In Anbetracht dieser Rahmendaten ist über die russische Wirtschafts- und Geldpolitik derzeit nur ein Urteil möglich: Sie hat sich mit konservativem Denken in eine ökonomische Sackgasse manövriert. Selbst ohne Sanktionen des Westens steckt Russlands Wirtschaft in der Stagnation.
Eine ausführlichere Version dieses Beitrags als FES-Perspektive „Vom Wirtschaftswunder in die Dauerkrise: Russlands Ökonomie vor einem Wendepunkt?“ finden Sie hier (PDF, 300 KB).



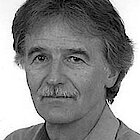



3 Leserbriefe
Wir sind alle im Globalen Wettbewerb die Wirtschaft braucht neue Märkte und wir sind alle miteinander Vernetzt Wirtschaftlich und auch die Sozialen Kontakte sind durch die Russischen Bürger in Europa nicht mehr wegzudenken.
Die Wirtschaft in Russland hat funktioniert das sind man an Sotschi.
Denn durch die Globale Wirtschaft ist das gegeben.
Darum ist der Artikel nicht in der Realen Welt angekommen.
Siehe Autos ;Wirtschaftskraft und Soziale Aspekte.
Denn Russland ist ein Vielvölkerstaat mit großen Geist und Wirtschaftskraft ?