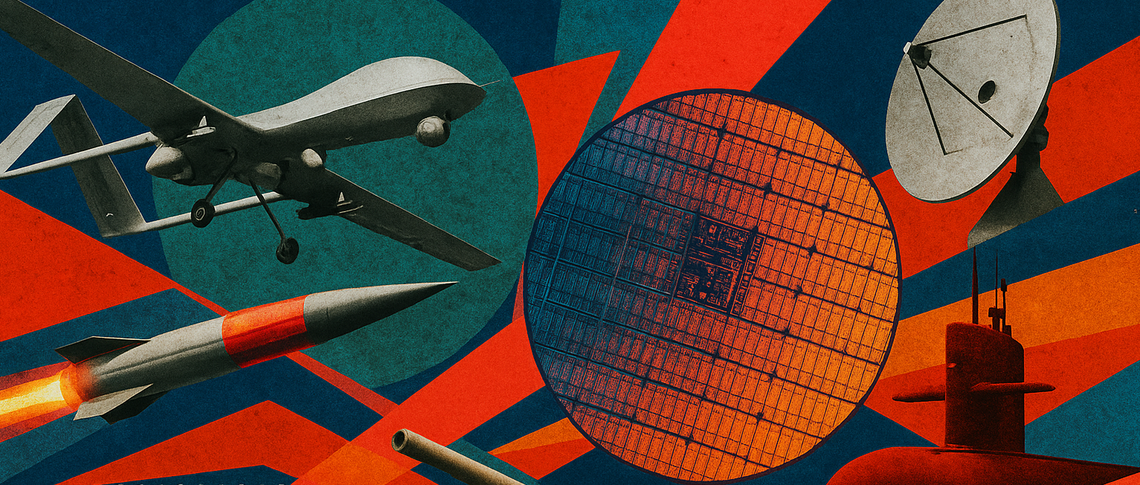Europa ist in die geopolitische Realität zurückgekehrt. Wir leben in einer Zeit, in der Frieden kein Zustand mehr ist, sondern eine Aufgabe. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Unterstützung für Moskau und die wachsende Konfrontation zwischen den USA und China verändern Europas sicherheitspolitisches Umfeld grundlegend. Hinzu kommen Zweifel an der US-Beistandsgarantie im Rahmen der NATO sowie russische Drohungen gegen das Baltikum.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte es beim Start des europäischen Verteidigungsplans ReARM Europe auf den Punkt: „Wir leben in den bedeutsamsten und gefährlichsten Zeiten. Die eigentliche Frage ist, ob Europa bereit ist, so entschlossen zu handeln, wie es die Lage erfordert.“ Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnte jüngst: „Die Gefahr bewegt sich mit voller Geschwindigkeit auf uns zu. Es ist Zeit, in eine Kriegsmentalität zu wechseln – und unsere Verteidigungsproduktion zu beschleunigen.“
Mit dem ReARM Europe-Plan in Höhe von 800 Milliarden Euro und der Ankündigung, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen, reagieren EU und NATO auf die dramatische Verschlechterung des Sicherheitsumfelds. Doch die entscheidende Frage lautet: Wofür genau sollen diese Summen eingesetzt werden?
Die Realität in der Ukraine zeigt: Entscheidend ist längst nicht mehr die Zahl der Panzer, sondern die Kombination aus Automatisierung, Echtzeitdaten und digital integrierter Waffentechnik. Softwaregesteuerte Hardware – schnell, präzise, skalierbar – ist der Schlüssel. Mit dem Rapid Adoption Action Plan will die NATO disruptive Technologien innerhalb von 24 Monaten in die Truppen integrieren. Eine Studie des Bruegel-Instituts warnt: „Der Verlust technologischer Führungsfähigkeit in der Kriegsführung wird zu einem wachsenden Problem – besonders für Europa.“ Drohnen, Satellitenkommunikation, Hyperschallwaffen und KI-gestützte Systeme sind keine Zukunftsmusik, sondern Technologien der Gegenwart. Und sie haben eins gemeinsam: Sie erfordern enorme Mengen an Rohstoffen.
Um die auf dem NATO-Gipfel 2025 vereinbarten Fähigkeitsziele zu erreichen, verpflichtet sich die Allianz mit dem Defence Production Action Plan zu einer massiven Ausweitung der Rüstungsproduktion. Parallel dazu wurden eine Defence-Critical Supply Chain Roadmap sowie eine Liste kritischer Rohstoffe, welche die Versorgungssicherheit innerhalb der EU gewährleisten soll, verabschiedet. Denn das Hochfahren der Produktion erfordert diese Materialien in immer größeren Mengen.
Schon ein kurzfristiger Exportstopp würde massive Verzögerungen und Preisexplosionen auslösen.
Für Drohnenbatterien wird Lithium benötigt – und rund 70 Prozent der weltweiten Weiterverarbeitung dieses Rohstoffs findet in China statt. Das Land kontrolliert zudem 70 bis 80 Prozent der globalen Drohnenproduktion sowie 70 Prozent der Batterieproduktion. Schon heute blockiert Peking den Export bestimmter Komponenten an US-Unternehmen. Ein deutliches Warnsignal auch für Europa.
Gallium, das für Halbleiter in Radar- und Infrarotsystemen benötigt wird, ist ein weiterer Engpass. Der Bau einer Fregatte oder eines Luftabwehrsystems erfordert mehr als 100 Kilogramm Galliumarsenid-Halbleiter. Auch hier kontrolliert Peking den Weltmarkt. China produziert rund 90 Prozent des weltweiten Galliums und hat die Ausfuhren massiv gedrosselt. Im März 2025 wurden nur noch 300 Kilogramm exportiert – sämtlich nach Deutschland.
Seltene Erden sind wiederum unverzichtbar für Hochleistungsmagnete, wie sie in Satelliten, U-Booten und Präzisionslenkflugkörpern verwendet werden. Auch hier veredelt China nahezu alle Seltenerd-Metalle und produziert rund 90 Prozent der Magnete. Neue Exportkontrollen aus Peking würden westliche Industrien entsprechend empfindlich treffen.
Diese Abhängigkeit ist strategisch gefährlich. China dominiert bei vielen dieser Metalle den Weltmarkt und nutzt diese Position zunehmend als geopolitisches Druckmittel. Schon ein kurzfristiger Exportstopp würde massive Verzögerungen und Preisexplosionen auslösen. Eine längerfristige Unterbrechung könnte Schlüsseltechnologien lahmlegen und Investoren verunsichern. Kritische Rohstoffe sind daher kein „Nice-to-have“, sondern das Material der Wehrhaftigkeit.
Früher entschieden Öl- und Gaslieferungen darüber, wie wirtschaftlich und geopolitisch handlungsfähig Staaten waren. Heute sind es Lithium, Gallium, Germanium und Seltene Erden – die Aktivatoren moderner Waffensysteme. Europas Antwort muss dreigleisig sein: den Zugriff sichern, die Resilienz stärken und integrierte Lieferketten ausbauen.
Erstens muss Europa gezielt Lieferanten außerhalb riskanter Monopole für sich gewinnen. Das gelingt durch Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Staaten und durch die Förderung von Bergbauprojekten in stabilen Regionen. Dies muss mit einer strategisch ausgerichteten Export-, Investitions- und Handelspolitik verknüpft werden. Staatliche Unterstützung ist dabei unverzichtbar – insbesondere bei der Finanzierung neuer Rohstoffprojekte, die ohne öffentliche Förderung kaum realisierbar wären.
Auch gilt es, die Rohstoffproduktion in Europa selbst wieder hochzufahren. Verarbeitung, Veredelung und Fertigung – also die wirklich wertschöpfenden Schritte – müssen zurück auf den Kontinent geholt werden. Dafür braucht es staatliche Investitionen, regulatorische Erleichterungen, verlässliche Rahmenbedingungen – etwa niedrigere Strom- und Energiepreise – sowie öffentlich-private Partnerschaften. Rohstoffe „Made in Europe“ sind die beste Rückversicherung gegen geopolitische Erpressung.
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist ebenso entscheidend. Recycling ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch strategisch klug. Alte Fahrzeuge, Elektronikschrott und Bergbauabfälle enthalten beträchtliche Mengen kritischer Rohstoffe. Europas Recyclingindustrie braucht gezielte Förderung und klare Anreize, um Sammlung, Aufbereitung und Rückgewinnung im industriellen Maßstab zu ermöglichen.
Produktionskapazitäten müssen jederzeit hochgefahren werden können, wenn geopolitische Spannungen eskalieren.
Zweitens können technologische Innovationen helfen, einseitige Abhängigkeiten zu verringern und damit die Resilienz zu stärken. Forschung zu neuen Produktionsverfahren, Ersatzmaterialien, effizienteren Magneten und batterielosen Energiespeichern muss strategisch priorisiert werden – mit klarem Fokus auf Sprunginnovationen statt auf schrittweise Verbesserungen.
Drittens braucht Europa integrierte Liefer- und Wertschöpfungsketten, wie sie auch im Draghi-Bericht zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit skizziert werden. Dazu kann eine strategische Lagerhaltung für besonders sicherheitsrelevante Sektoren – etwa die Verteidigungsindustrie – gehören. Eine intelligente Vorratshaltung darf kein symbolischer Hamsterkauf sein, sondern muss als rotierendes System funktionieren, das im Krisenfall eine sofortige Produktionsausweitung ermöglicht. Produktionskapazitäten müssen jederzeit hochgefahren werden können, wenn geopolitische Spannungen eskalieren.
Deshalb sollten auch Start-ups und die öffentliche Beschaffung gezielt als Hebel genutzt werden. Unternehmerische Innovationen in den Bereichen Recycling, Materialersatz und intelligentes Lieferkettenmanagement sind sicherheitspolitisch relevant – denn wirtschaftliche und nationale Sicherheit überschneiden sich zunehmend. Öffentliche Auftraggeber sollten zudem in Ausschreibungen verbindlich festschreiben, dass kritische Rohstoffe aus sicheren Herkunftsländern stammen.
Diese Maßnahmen sind zwar teuer, Handlungsunfähigkeit wäre jedoch unbezahlbar. Wer Milliarden in neue Systeme investiert, muss zugleich in die Rohstoffbasis investieren, die sie möglich macht. Geld in Waffensysteme ohne Materialbasis ist wie ein Panzer ohne Motor. Abschreckung und militärische Handlungsfähigkeit müssen industriell abgesichert werden. Geld allein reicht nicht – ohne Rohstoffe bleibt jedes Rüstungsprogramm Papier.
Militärische Überlegenheit bemisst sich heute nicht mehr an Stückzahlen, sondern an der Gewissheit, dass Metalle, Batterien und Halbleiter auch dann verfügbar sind, wenn es darauf ankommt. Nicht einzelne Waffensysteme entscheiden Kriege, sondern die Lieferketten, die ihren Einsatz ermöglichen. Eine strategische Rohstoffpolitik ist die Basis für eine verlässliche Sicherheitspolitik.