Drei Wochen vor dem ersten Wahlsieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin im März 2000 veröffentlichte sein Wahlkampfteam ein Buch mit dem Titel Aus erster Hand: Gespräche mit Wladimir Putin, das auf Grundlage von 24 Stunden an Interviews mit drei Journalisten verfasst wurde. Mit Zitaten wie „Das Leben ist so eine einfache Sache, wirklich” offenbarte dieses Buch jene tiefe Überzeugung, die Putins Führungsstil zugrunde liegen sollte: Eine komplexe Welt kann und muss vereinfacht werden.
Diese mittlerweile im russischen Establishment verbreitete Weltsicht stammt nicht von Putin selbst, sondern von einer im Dezember 1999 gegründeten Denkfabrik unter der Leitung von German Gref, der unter Putin später zum Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel aufstieg. In Erwartung eines Wahlsieges Putins lud Grefs Zentrum für strategische Forschung Experten ein, zwei Programme zu entwickeln – eines für die Wirtschaft, das andere für eine Reform der öffentlichen Verwaltung – wobei beide einer fundamentalen Vorgabe zu folgen hatten: Die Dinge nicht zu komplizieren.
Fünfzehn Jahre später spiegelt sich diese Obsession von der Vereinfachung der Systeme und Strukturen in Putins Ideologie sowie sämtlichen Strategien und Aktivitäten wider. Die Gewaltenteilung in der Regierung ist zu ineffizient, weswegen das Präsidentenamt die Oberhand über alle anderen Teilbereiche behalten muss. Die große Zahl politischer Parteien mit eigenem Parteiprogramm ist zu kompliziert und daher auf eine kurze Liste mit wenigen anerkannten Parteien zu reduzieren, wobei die Repräsentation der Macht (dauerhaft) einer Partei obliegt. Freie Meinungsäußerung leistet unproduktiven Misstönen der Empörung Vorschub, weswegen die Medien klare Vorgaben für ihre Berichterstattung zu erhalten haben.
Außerdem gab es Putins Regime zufolge auch zu viele öffentliche Institutionen, die zu vielen Aktivitäten nachgingen und unter unzureichender Aufsicht standen, so dass man diese Einrichtungen verkleinerte und ihnen spezielle Aufgaben aus einer kurzen zentralisierten Prioritätenliste zuteilte. Überdies fand man es schwierig, eine Vielzahl an höheren Gerichten zu unterhalten, weswegen diese durch einen einzigen Gerichtshof ersetzt wurden.
Auch die Problemlösungen wurden vereinfacht
Anstatt differenzierte Lösungen für vielschichtige Probleme zu entwickeln – ein Ansatz, der sorgfältige Abwägung erfordern würde, von Fehlern und Anpassungen ganz zu schweigen – wurden sämtliche Fragen, von Korruption im öffentlichen Bereich bis hin zu Unternehmensführung, eindimensional betrachtet.
Die von Putins Regime an den Tag gelegte Abneigung gegen Komplexität hat sich mit der Zeit intensiviert. Von der relativ harmlosen Überzeugung, wonach Einfachheit zu Klarheit, Überschaubarkeit, Berechenbarkeit und Sicherheit führt, gelangte man zu der gefährlichen Schlussfolgerung, dass die naturgemäß unberechenbare und oftmals undurchdringliche Komplexität eine Bedrohung darstellt. Unter allen Umständen gilt es, komplexe oder komplizierte Gedanken und Institutionen zu zerschlagen, die als Schöpfung eines machtvollen Expertentums betrachtet werden, die der Feind absichtlich zur Verwirrung und Verletzung Russlands in die Welt setzt.
Diese Schwarz-Weiß-Perspektive mag wie eine Fortsetzung der Weltsicht aus der Sowjetära erscheinen. Doch in den 1990er Jahren erzielte Russland beträchtliche Fortschritte in Richtung Modernisierung – und das nicht nur, weil man begann, staatliche Institutionen westlicher Prägung aufzubauen. Die wichtigste Triebkraft hinter der Modernisierung Russlands bestand in der Bildung einer neuen sozialen Ordnung auf Grundlage von Freiheit, Vielfalt und der Erkenntnis, dass eine moderne Welt vielfältige Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in Bereichen wie Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik bot.
Bevor sich jedoch eine offene Gesellschaft vollständig etablieren und die damit verbundene Haltung Fuß fassen konnte, wurde die Entwicklung von Putins Ansatz „Einfachheit ist besser“ eingeholt. Die Ansicht, wonach sich individuelle Chancen und Heterodoxie einer allgemeinen Berechenbarkeit unterzuordnen hätten, bewog die politische Elite, für sich Allwissenheit zu beanspruchen und Einmischung von außen als die größte Bedrohung für Russlands Zukunft darzustellen.
Von diesen Überzeugungen angetrieben, versuchte eine Union von „Liberalen“ eine Art bürokratische Modernisierung herbeizuführen, nachdem sie sich selbst davon überzeugt hatten, dass man mit einer korrupten Bürokratie und begrenzt demokratischen Institutionen zu liberalen politischen Ergebnissen gelangen könnte. Wenig überraschend scheiterte man mit diesem Vorhaben.
Innerhalb von nur wenigen Jahren wurde nicht nur deutlich, dass man in einer zwangsläufig komplexen Welt mit „einfachen“ Lösungen keine Resultate erzielte, sondern auch, dass Beschränkungen der Demokratie in Kombination mit bürokratischer Kontrolle von oben nach unten die idealen Voraussetzungen für persönliche Bereicherung schufen. Die Zerstörung der demokratischen Institutionen war nun sowohl von dem Wunsch nach Einfachheit als auch von purer Gier getrieben. Das russische Sprichwort „Einfachheit ist schlimmer als Diebstahl“ erwies sich als ungewöhnlich weitblickend.
Das jüngste Opfer des Strebens nach Einfachheit ist die Wissenschaft
Obwohl zunächst nicht als Bedrohung eingestuft, hat sich die Wissenschaft innerhalb der eng begrenzten sozialen und politischen Ordnung von heute zu einem Symbol der Autonomie und Vielfalt entwickelt.
Aus diesem Grund beanspruchte Putin nach seiner Wiederwahl für eine dritte – ungesetzliche – Amtszeit als Präsident die vollständige Kontrolle über die Russische Akademie der Wissenschaften. Unlängst wurde die 2002 vom bekannten Wissenschaftler und Telekommunikatonsmogul Dmitri Simin gegründete Stiftung „Dynastie“ vom Justizministerium in die Liste „ausländischer Agenten“ aufgenommen. Dies höchstwahrscheinlich mit dem Ziel, die Bemühungen der Organisation zur Schaffung einer modernen wissenschaftlichen Gemeinde zurückzudrängen. Denn die „ausländische Finanzierung“ dieser Stiftung – und Grund für ihren Listeneintrag – stammt nach Angaben Simins von seinen eigenen Bankkonten.
Diese Repression zeigte ernsthafte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Gemeinde. Nicht länger willens, in einem Umfeld zu bleiben, wo Kreativität und Forschergeist von Gier und Korruption erstickt werden, schlossen sich russische Top-Forscher den Investoren und dem Kapital an und flohen aus dem Land. Von 1990 bis 2010 verließen 70 Prozent der führenden russischen Mathematiker und die Hälfte der theoretischen Physiker das Land für immer. Biologen, Chemiker, Techniker und andere Experten wanderten auf der Suche nach besseren Chancen ebenfalls aus. Dieser Trend wird sich nur noch weiter beschleunigen, nachdem Putins Regime die Angriffe in diesem Bereich weiter intensiviert.
Die repressive Atmosphäre einer grauen, staatlich verordneten Einfachheit hat sich schließlich in alle Lebensbereiche Russlands eingeschlichen. Für die Zeit nach dem Ende von Putins Regime – das zwangsläufig, vielleicht sogar schon bald, kommen wird – bleibt zu hoffen, dass die Russen verstehen, dass der Weg in eine offene, moderne Gesellschaft niemals einfach ist.
© Project Syndicate


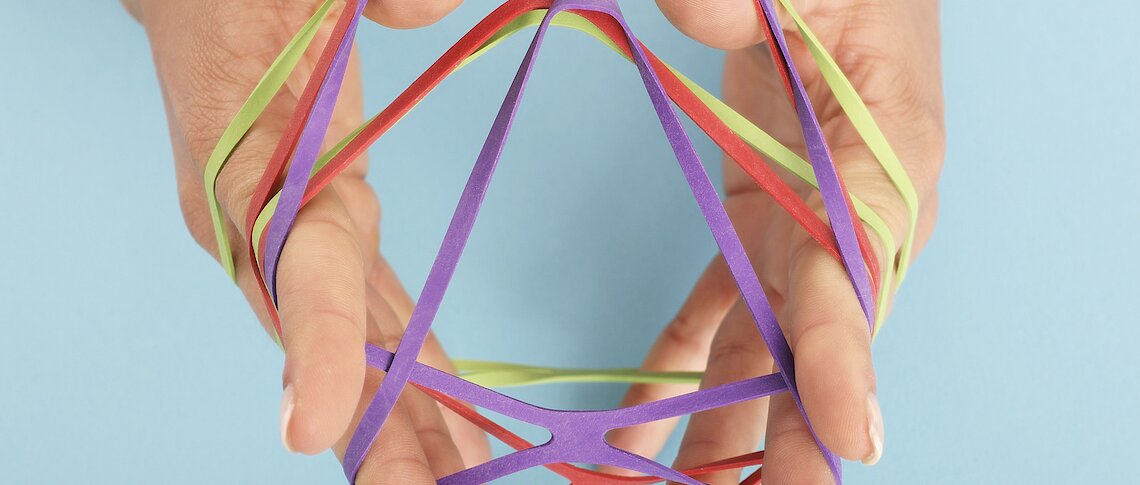




10 Leserbriefe
Sind wir im Westen vielleicht Russland doch viel ähnliches als wir meinen.
Ist doch immer wieder schön, wenn man jemanden im "Feindesland" findet, der die eigene Meinung bestätigt, gegen ein missliebiges Regime (Putin) pöbelt und damit dazu beiträgt, dass wir - der Westen - gegenüber uns selbst bestätigen können, dass wir auf der richtigen Seite stehen.
Blöd nur, wenn es die Mehrheitsgesellschaft in Russland anders sieht. Der Autor vereinfacht scheinbar. Wie passt das mit seinem Ansinnen zusammen?
Die Welt so einfach in schwarz und weiss, richtig und falsch aufzuteilen, funktioniert nicht.Da man dazu neigt neue Entwicklungen nicht kommen zu sehen, die sind anfangs klein, dann ist man nicht vorbereitet, wenn sie stärker werden, und man hätte sich damit beschäftigen können, vorher, rechtzeitig.
Russland heute, unter der Führung von Putin schaut so aus:
- man hat die Landwirtschaft vernachlässigt, nicht nötig. Geld floss von draussen rein durch Öl und Gas. Hätte man aufgepasst, überlegt, was ist, wenn das funktioniert in den USA, und riesige Mengen sind neu im Markt, was passiert dann mit dem Preis den wir brauchen?
Anfangs ein kleines Problem, nun existenzbedrohend
- de Fakto hat Russland keine Industrie mehr. Auch anfangs nur ein kleines Problem...
Jetzt mit den Sanktionen kommt raus, ohne Know-How, Chips von draussen, kann man noch nicht einmal einen Staubsauger bauen.
Wenn man überlegt: Russland hört hinter dem Ural im Prinzip auf, dann sind es nur noch nur noch 100 Mio. Russen.
Wenn man nun überlegt, dass die Russen nur ein Drittel des BIP pro Kopf wie die Amis und Europäer erwirtschaften, und dafür noch auskömmliche Energiepreise als Input benötigen,
dann will Putin mit mit real Power von 35-40 Mio. Russen Weltmacht spielen.
Davon abgezweigt muss die Alimentierung der Krim, der `Urlaub` russischer Soldaten in der Ukraine.
Russlands Reserven zehren sich nund rasend schnell auf. Überall verzettelt man sich.
Verschleudert man Potential.
Das ist Lebensstandard der Bevölkerung, die diese Art Denke verinnerlicht hat.
Putin fällt. 2 Jahre noch.
Nur was passiert, wenn ein Staat wie Russland implodiert? Mit Atomwaffen?
...
Wer sich länger mit osteuropäischen Managementstrukturen beschäftigt hat, kann eigentlich nicht sonderlich überrascht sein, wenn er dieses kurze Statement liest. Viele Betriebe sind dort bis heute streng hierarchisch und marktfern organisiert. Der einzelne Mitarbeiter gibt sich meist gar nicht Mühe über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Mitzudenken würde nur Verdacht erwecken. Veränderungen anzuregen hiesse dem Chef zu widersprechen. Diese Form selbstgesuchter Unselbständigkeit schafft Sicherheit und verleiht dem Chef ein Gefühl von Macht. Kunden- oder Problemorientierung sind Fremdwörter in seiner solchen Welt und stören nur den Ablauf im Unternehmen. Mich wundert es überhaupt nicht mehr, dass die Modernisierung der russischen Wirtschaft so schleppend verläuft.
Der Artikel ist außerordentlich interessant und bietet eine neue Perspektive auf das heutige Russland und der Heransgehensweise der Regierung sowie der herrschenden Klasse dort. Vielen Dank für diesen Beitrag.
Die leise Unterstellung des zweiten Kommentars, dass der russische Wissenschaftler heute keine eigene Meinung mehr hat, spricht für sich und stützt die genannte Troll-These. Auch hier findet keine inhaltliche Auseinadersetzung statt. Warum verfassen hier so viele Leser einen Kommetar, wenn sie inhaltlich eigentlich nichts zu sagen haben, außer dass sie die Aufassung nicht teilen? Das ist hier doch keine Facebook-Seite, wo ich lediglich like und dislike drücke. Oder etwas doch?
Gerade in Russland gibt es ein gewaltiges Potenzial an kreativen Mesnchen, das sich aufgrund restriktiver gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht adäquat entwickeln kann. Dies ist nicht nur eine Schande und ein großer Schaden für die Russische Föderation, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft. Die russische Führung mehrt diesen Schaden, indem sie kritische Stimmen ausschaltet, eine eigene "Wirklichkeit" kreiert und die Zivilgesellschaft auszuschalten sucht. Cui bono?