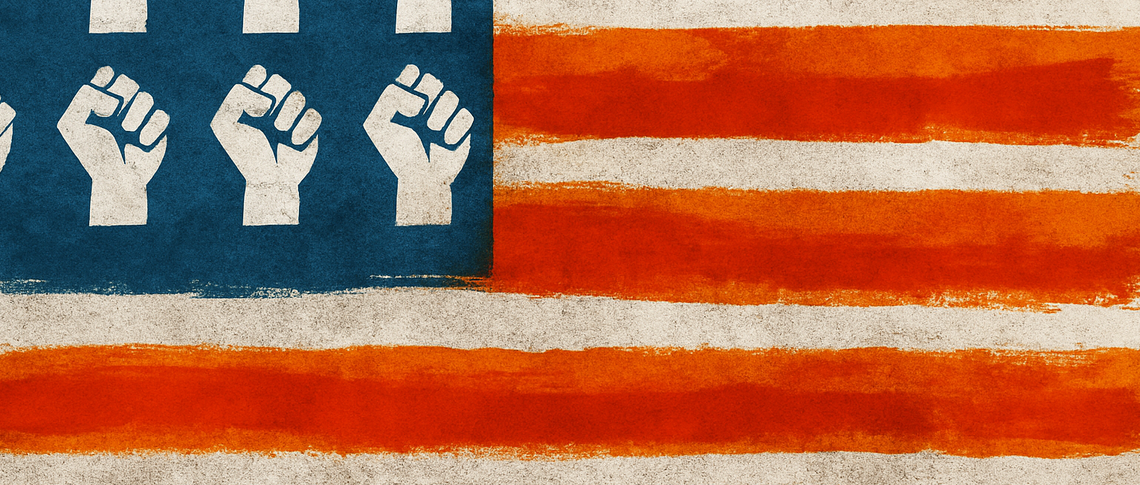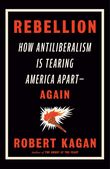
Der US-amerikanische Historiker und Kolumnist Robert Kagan hat sich in seinen Büchern zumeist mit amerikanischer Außen- oder Weltpolitik beschäftigt und auch selbst versucht, US-Politik mitzugestalten: im Außenministerium unter Ronald Reagan etwa, als einer der Vordenker der Neo-Cons oder als außenpolitischer Berater des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers John McCain. Den Rezensenten und viele andere Europäer hat er verärgert, als er europäische Kritik am Irak-Krieg George W. Bushs mit dem schlichten Argument abtat, die Europäer seien eben „von der Venus“ und lebten in einem eigenen, realitätsfernen Paradies – der zentralen These seines 2003 erschienenen Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. In späteren Büchern hat Kagan Positionen bezogen, die auch für diejenigen Europäer anschlussfähig waren, die weiter auf die Zügelung von Macht durch Recht und Regeln setzen. So tritt er in The Jungle Comes Back. America and Our Imperiled World (2018) dafür ein, die überlegene Macht der USA weiterhin – trotz aller Fehler amerikanischer Politik – für den Erhalt der von Amerika selbst maßgeblich geprägten internationalen Ordnung einzusetzen. Streitbar und gleichzeitig elegant geschrieben waren seine Bücher immer.
Das gilt auch für Rebellion. How Antiliberalism is Tearing America Apart Again, Kagans jüngstes Buch. Hier geht es einmal nicht um die weltpolitische Rolle der USA, sondern um deren innere Entwicklung. Es ist ein langer Essay über die Geschichte der USA von der amerikanischen Revolution bis zu den Präsidentschaftswahlen von 2024 – eine Geschichte, die Kagan als anhaltenden Kampf zwischen Liberalismus und Antiliberalismus beschreibt. Liberalismus ist für ihn im Kern die Überzeugung der Gründer, dass alle Menschen gleich und mit unveräußerlichen Rechten auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück geschaffen sind. Die wichtigste Funktion dieses in die US-Verfassung gegossenen Liberalismus sei der Schutz „fundamentaler Rechte aller Individuen gegen den Staat und gegen die weitere Gemeinschaft“. Seit der Revolution habe jedoch stets auch eine große Zahl von Amerikanern diese liberale Grundhaltung abgelehnt.
Rebellion war zunächst vor den Präsidentschaftswahlen von 2024 erschienen; die vorliegende Ausgabe enthält ein Nachwort vom Januar 2025. Die Wahlen, heißt es in der Einleitung, seien ein Referendum über die „aus der Revolution geborene liberale Demokratie“ Amerikas. Der Kampf zwischen Liberalismus und Antiliberalismus, der dabei zum Ausdruck komme, sei keine historische Besonderheit, sondern „so alt wie die Republik“. Es gebe in der Geschichte der USA eine gerade Linie vom sklavenhaltenden Süden über den Ku-Klux-Klan, die Dixiecrats mit ihrer Rassentrennungspolitik, den McCarthyismus, den christlichen Nationalismus und die Neue Rechte bis hin zur heutigen, von der „Trump-Bewegung“ kontrollierten Republikanischen Partei. Dabei sei es immer darum gegangen, eine weiße christliche Suprematie aufrechtzuerhalten. Wo das liberaldemokratische System dies nicht zu garantieren versprach, seien Millionen Amerikaner bereit gewesen, gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu rebellieren.
Im ersten Kapitel skizziert Kagan die Konstituierung des amerikanischen Regierungssystems als einer Maschinerie zum Schutz individueller Rechte – mit allen Widersprüchen zwischen den an John Locke orientierten liberalen Vorstellungen der Gründer und den gesellschaftlichen Realitäten. So sei allen Beteiligten klar gewesen, dass die fortwährende Existenz der Sklaverei den Prinzipien universeller natürlicher Rechte widersprach, auf die die neue Nation sich gründen sollte. Die Gründer stellten die Verfassung als echten Gesellschaftsvertrag über die Legislative, die ihrer Auffassung nach allein keine Garantie gegen tyrannische Herrschaft darstelle. Und sie seien davon ausgegangen, dass gesellschaftliche Gruppen, die zu ihrer Zeit noch nicht als freie Bürger anerkannt waren, ihre Rechte zukünftig einfordern würden.
Im zweiten und dritten Kapitel skizziert Kagan die antiliberale Tradition Amerikas als „mächtige und anhaltende abweichende Meinung“. Demokratisch sei diese Tradition nur im Sinne einer exklusiv weißen Demokratie gewesen. Sklaverei sei im Süden mehrheitlich, nicht nur von reichen Plantagenbesitzern, verteidigt worden. Das Festhalten erst an der Sklaverei und nach dem Bürgerkrieg an weißer Vorherrschaft und der Ablehnung neuer Einwanderer sei auch mit der Fixierung amerikanischer Konservativer auf eng begrenzte zentralstaatliche Regierungskompetenzen (small government) einhergegangen.
Trumps Wahlerfolg sei nicht durch wirtschaftliche Faktoren zu erklären.
Die antiliberalen Kräfte hätten nach und nach an Einfluss verloren – unter anderem durch die Wellen nicht-protestantischer und nicht-weißer Einwanderung im 19. Jahrhundert, durch Roosevelts New Deal, durch den Zweiten Weltkrieg, der „die Idee rassischer Hierarchien“ grundsätzlich infrage gestellt habe, und durch die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. Allerdings hätten sich die Liberalen, so Kagans zentrale These, fortwährend der Illusion eines „unvermeidbaren moralischen Fortschritts in Richtung Liberalismus“ hingegeben und im antiliberalen Konservatismus keine ideologische Alternative zu ihrem Modell gesehen, sondern diesen mit Anpassungsschwierigkeiten an die Modernität erklärt, die mit der Zeit überwunden werden würden. Dies sei jedoch keineswegs so. Vielmehr gebe es weiterhin eine große Zahl von Amerikanern, die fundamental antiliberal seien.
Das habe sich – wie im fünften Kapitel ausgeführt – im Aufstieg der Neuen Rechten, in der Ablösung der liberal-konservativen Führung der Republikaner und darin gezeigt, dass die Wahl des ersten schwarzen US-Präsidenten offen rassistische Reaktionen ausgelöst habe. Antiliberalismus wende sich heute auch gegen die Gleichstellung sexueller Minderheiten und gegen jede Form von wokeness – wobei Letztere „nichts anderes [sei] als eine Forderung nach Respekt für Gruppen, die lange für die Anerkennung ihrer fundamentalen natürlichen Rechte gekämpft haben“.
Die Antiliberalen könnten selbst sehen, heißt es im sechsten Kapitel, dass sie demografisch auf der Verliererseite stehen. Antiliberale Intellektuelle setzten deshalb auf die „rebellische Zerstörungskraft der Trump-Bewegung, um die liberale ‚Elite‘ zu stürzen und zu ersetzen“. Trump, so Kagan im siebten Kapitel, habe sich bereits vor 2016 als weißer Suprematist etabliert, und die Trump-Bewegung sei „die größte Rebellion gegen die … verfassungsmäßige liberale Ordnung seit dem Bürgerkrieg“. Trumps Wahlerfolg sei nicht durch wirtschaftliche Faktoren zu erklären: Weiße Wähler aus der Arbeiterschicht seien aus „rassischen“ Gründen, nicht aus sozialen oder wirtschaftlichen („for reasons of race, not class“) zu Trump gewechselt. Gegenwärtige politische Trends ähnelten tatsächlich „denen, die dem Bürgerkrieg vorangingen“. Langfristig seien die Aussichten für den amerikanischen Liberalismus jedoch gut, schon weil die demografische Entwicklung die politische und gesellschaftliche Dominanz einer einzelnen ethnisch-religiösen Gruppe unmöglich mache.
Der Anfang 2025 verfasste Nachtrag ist etwas pessimistischer. Man dürfe nicht ignorieren, so Kagan, „dass Millionen von Amerikanern attraktiv fanden, was Trump ihnen verkaufte: kein ökonomisches Programm, sondern einen Angriff auf die liberalen Prinzipien der amerikanischen Gründer: auf den Glauben an die Gleichheit der Menschen und universelle individuelle Rechte“. Die Wähler hätten sich bei den Wahlen entschieden, mit etwas anderem als liberaler Demokratie zu experimentieren. Ob sie mit den Konsequenzen zufrieden sein werden, sei eine offene Frage.
Kagans nach innen gerichteter Blick auf die amerikanische Geschichte ist gleichermaßen idealistisch und sehr amerikanisch: Er vertritt konsequent die These – die viele seiner Landsleute bestreiten dürften –, dass es die Geisteshaltung sei und nicht die wirtschaftliche Entwicklung, die das Wahlverhalten bestimme. Er bindet auch gegenwärtige politische und gesellschaftliche Konflikte immer wieder an die philosophischen Überlegungen der Gründer zurück, die in Amerika die erste liberale Demokratie der Welt errichteten. Kagan ist in sich konsistent. Doch man kann fragen, ob er bei seiner Erklärung der Wahlsiege Trumps materielle Faktoren wie die globalisierungsbedingten neuen Ungleichheiten unterschätzt. Trump hat schließlich nicht nur unter weißen, männlichen und christlichen Wählern zugelegt. Und welche Rolle spielen die neuen, libertären Tech-Oligarchen oder die Vertreter der fossilen Industrie, die sich Trump als Rammbock gegen staatliche Regulierung ausgesucht haben? Passen sie überhaupt in das Liberalismus-Antiliberalismus-Schema?
Kagan stellt diese Fragen nicht. Seine Frage jedoch, ob die Verfassung und Amerikas liberale Demokratie „eine ganze Administration voll antiliberaler Intellektueller und Politiker“ überleben werde, ist in der Tat relevant. Nicht nur für Amerika, sondern auch für den Rest der Welt.