Wenn Politiker wie Obama und Putin sich trotz weltweiter Krisen und Konflikte jahrelang aus dem Weg gehen, ist das ein Alarmzeichen. Wie können Kriege beendet und Konflikte beigelegt werden, wenn Spitzenpolitiker nicht miteinander reden? Wenn keiner den ersten Schritt unternimmt, bieten die Vereinten Nationen (UN) einen Ausweg. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Anlass des 70. Jahrestages der Weltorganisation im September dieses Jahres in New York bot den beiden Präsidenten die Chance, über den eskalierenden Krieg in Syrien und die Entwicklung in der Ukraine direkt miteinander zu reden. Sie haben sie genutzt. Natürlich bieten Spitzentreffen keine Erfolgsgarantie, aber Sprachlosigkeit hat noch nie zum Erfolg geführt. Dieses Exempel unterstreicht die Bedeutung der UN in der Weltpolitik: Als einzige völkervertragsrechtlich verfasste Organisation, die über eine universelle Mitgliedschaft der Staaten dieser Erde verfügt, ist und bleibt sie ein unverzichtbares Forum der internationalen Diplomatie.
Die aktuelle internationale Lage ist von Krisen, Staatenzerfall und einer Erosion bestehender Regionalordnungen geprägt. Dementsprechend fallen die Bilanzen der Beobachter über die Leistungen der UN häufig kritisch aus. Sie zitieren gern die Prinzipien und großen Ziele der Weltorganisation und konfrontieren sie umgehend mit den blutigen Realitäten unserer Gegenwart, um dann rasch den Schluss zu ziehen, dass die UN versagt hätten.
Die UN gibt es genau genommen gar nicht.
Aber so einfach darf man es sich nicht machen. Die UN gibt es genau genommen gar nicht. Bereits in der Gründungsphase haben interessierte Mitglieder, vor allem Großbritannien, alles darauf angelegt, dass die UN eine dezentrale Organisation sind. Sonderorganisationen wie beispielsweise die FAO oder die UNESCO operieren unabhängig von der Hauptorganisation; mit ihr gibt es lediglich eine Koordination der Aufgaben und Aktivitäten, Weisungen aus New York sind aber nicht möglich. Auch andere, formal abhängige Unterorganisationen haben sich praktisch verselbstständigt.
Zudem gibt es UN-Gremien, die von Experten gestellt werden, wie beispielsweise die Internationale Rechtskommission, die Vorschläge zur Weiterentwicklung des Völkerrechts unterbreitet. Diese Gremien genießen eine bestimmte Unabhängigkeit, zahlen dafür aber oft den Preis, von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht gehört zu werden. Von ihnen wiederum unterscheiden sich die Organe, die sich aus den Mitgliedstaaten zusammensetzen. Dazu zählen etwa die Generalversammlung, der alle 193 Mitgliedstaaten angehören, oder der Menschenrechtsrat. Hier zeigt sich in besonderem Maße, in welche Widersprüche sich die UN begeben, wenn ein Staat wie Saudi-Arabien, das massiv gegen die Menschenrechte verstößt, den Vorsitz im Rat erhält.
Möchte man den UN gerecht werden, stellt sich immer die Frage, welcher Akteur der dezentralen Organisation eigentlich gemeint ist. Nicht zufällig kommt es daher zu unterschiedlichen Bewertungen der verschiedenen Organe der UN. Im Westen dominiert wegen der Blockade des Sicherheitsrates der kritische Blick auf die Weltorganisation. In Afrika dagegen werden die Spezialorgane wie UNICEF, UNHCR oder WHO, die sich Problemen wie Dürren, Hungersnöten, Flüchtlingselend und Seuchen annehmen, weitaus positiver gesehen.
Es ist nicht fair, dass die Regierungen die Lorbeeren einheimsen, wenn der UN-Multilateralismus Erfolge zu verzeichnen hat, aber die Schuld der Weltorganisation zugeschoben wird, wenn genau dieser Multilateralismus scheitert.
Voraussetzung für eine angemessene Beurteilung der UN ist die grundlegende Einsicht, dass die Weltorganisation in erster Linie eine Staatenorganisation ist. Zu Recht betonen Kenner, dass die UN immer nur so gut oder schlecht sind, wie die Mitgliedstaaten sich einbringen. Sie ist eine Organisation, die nicht über eigene Finanzen, Militär, Polizei und andere Ressourcen verfügt. Deshalb ist es nicht fair, dass die Regierungen die Lorbeeren einheimsen, wenn der UN-Multilateralismus Erfolge zu verzeichnen hat, aber die Schuld der Weltorganisation zugeschoben wird, wenn genau dieser Multilateralismus scheitert.
Das Leitmotiv der Gründung der UN vor 70 Jahren nach dem verheerenden 2. Weltkrieg lautete, „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“. Dieses ehrgeizige Ziel wurde offensichtlich verfehlt. Heute erschüttern zahlreiche Konflikte die Welt: in Syrien, Irak, Südsudan, Mali, Ukraine, Jemen oder Afghanistan. Klar ist aber auch, dass kein Land allein in der Lage ist, der Konflikte und ihrer Folgen wie Flucht und Hunger Herr zu werden. Auch dort, wo die UN nicht vorankommen, werden ihre Mitgliedstaaten auf sie zurück verwiesen. Die UN bieten das einzigartige Forum, bei dem im Hinblick auf die jeweiligen Konflikte zuallererst ein gemeinsamer Wille gebildet werden kann. Nur wenn dies geschieht, konstituieren sich „vereinte“ Nationen, die ihre Partikularinteressen überwunden haben. Bilaterale Absprachen oder Koalitionen der Willigen sind keine Alternativen.
In diesem Kontext spielt der Sicherheitsrat der UN eine entscheidende Rolle. Er ist das Herzstück des Systems kollektiver Sicherheit, das Frieden und internationale Sicherheit herstellen soll. Die Gründe dafür, dass dies oft misslingt, sind bekannt: Die Mitglieder des Rates, vor allem die fünf ständigen Mitglieder, schaffen es nur bedingt, ihre nationalen Interessen so zu mediatisieren, dass gemeinsame Beschlüsse zustande kommen; oft lähmt das Veto-Recht der P5 das Gremium. Hinzu kommt, dass das Hauptorgan für die heutige Staatenwelt längst nicht mehr repräsentativ ist. Fachleute und selbstbewusste Schwellenländer pochen auf eine grundlegende Reform. Diese kommt aber seit Jahren nicht voran. Dabei geht es um eine Erweiterung, die großen Ländern aus Afrika, Lateinamerika und Asien ein Mitentscheidungsrecht einräumt, um eine qualifizierte Einschränkung des Veto-Rechts und um eine Erneuerung der Arbeitsmethoden.
Eine Reform der Friedenssicherung scheint da eher wahrscheinlich. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon initiierte in diesem Jahr einen Überprüfungsprozess der UN-Friedensmissionen, der UN-Friedenskonsolidierungsarchitektur sowie der Umsetzung der Resolution 1325, die die Rolle der Frauen in Friedensprozessen stärken möchte. Bei der Bewertung und Umsetzung der Expertenvorschläge muss Deutschland sich aktiv einbringen und mehr Verantwortung bei der Sicherung des Friedens übernehmen.
Bislang ist Deutschland mit 159 Soldaten – das entspricht nur 0,18 Prozent aller in UN-Friedensmissionen eingesetzten 95 000 Soldaten – und 20 Polizeikräften (0,15 Prozent) nicht gerade überrepräsentiert. Unsere Beteiligung an UN-geführten Stabilisierungsmissionen sollte auf zwei Ebenen ausgebaut werden: Es muss eine quantitative und vor allen Dingen auch eine qualitative Anhebung des deutschen Beitrags geben. Leider ist es Deutschland bisher nicht gelungen, sich adäquat in diesem Bereich zu engagieren, weil bei UN-Anfragen die von der Bundesregierung gemeldeten Fähigkeiten regelmäßig nicht zur Verfügung standen. Dies muss sich ändern. Wir sollten daher erwägen, neben einer größeren Beteiligung im zivilen und im Polizeibereich, den UN jene Fähigkeiten zuverlässig zur Verfügung zu stellen, die auf den von ihr erkannten Bedarf zugeschnitten sind und unseren politischen und militärischen Möglichkeiten entsprechen.
Es geht vor allem um die Beseitigung von Defiziten im anspruchsvollen technischen Bereich. Dazu gehören unter anderem Logistik, Feldlagerbau, Kommunikationstechnik, Pionierfähigkeiten, Aufklärungs- und Führungsfähigkeiten sowie Sanitätswesen. Angesichts immer größerer Opferzahlen durch Sprengfallen auch bei UN-Truppen gehört die entsprechende Ausbildung und Schutzausrüstung zu einem weiteren wichtigen Feld, in dem Deutschland sein Wissen und seine Fähigkeiten sinnvoll einbringen kann.
Deutschland sollte den UN nur die Fähigkeiten anbieten, die wir im Bedarfsfall auch bereit sind, zur Verfügung zu stellen. Bei Wahrung der parlamentarischen Beteiligungsrechte könnten wir diese Fähigkeiten dann verlässlich und innerhalb von 30 Tagen nach Anforderung der UN bereitstellen. Hierzu ist ein grundsätzliches Einvernehmen zwischen Bundestag und Bundesregierung erforderlich, wonach die UN als führende sicherheitspolitische Organisation im beschriebenen Rahmen von Deutschland unterstützt werden sollen. Dies wird auch in schwierigen Einsatzgebieten von UN-Friedenstruppen gelten müssen.


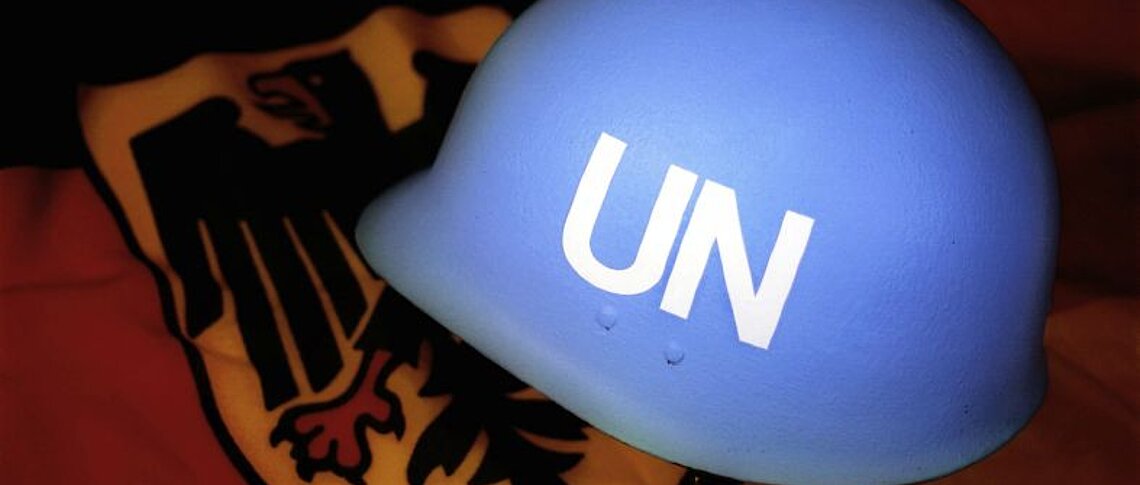




11 Leserbriefe
Vielleicht läßt sich das Problem dadurch lösen, daß Deutschland auf militärische Aktivitäten außerhalb von UN Mandaten grundsätzlich verzichtet.
So auch hier Niels Annen. Er behauptet einfach ohne jeden erkennbaren Zusammenhang mit dem vorher Geschriebenen: „Es muss eine quantitative und vor allen Dingen auch eine qualitative Anhebung des deutschen Beitrags geben.“ Kurz, er will, dass Deutschland sich in die internationalen Kriege mit Bundeswehrtruppen einmischt. Und das dann auch noch mit „... vor allem um die Beseitigung von Defiziten im anspruchsvollen technischen Bereich“ obwohl Deutschland gerade da ja selbst alle möglichen Defizite hat (vom Gewehr bis zum Truppentransporter M400). Die einfachen Landser sollen dann weiterhin die Pakistani, Indonesier, Senegalesen usw. stellen.
Nein, Deutschland gelingt es nicht einmal in Deutschland und Europa die Probleme zu lösen. In Afghanistan ist die einst friedliche Provinz Kundus nach dem Einsatz der Bundeswehr dort im Rahmen der UNO vom Bürgerkrieg zerfleischt, und große Teile in der Hand der Taliban und wir sind Ziel einer breiten Flüchtlingsbewegung von dort. (Mal abgesehen von dem Massaker an Zivilisten, dessen verantwortlicher Offizier danach auch noch zum General befördert wurde, und dem „Posieren“ deutscher Soldaten etc. also dem hässlichen Deutschen, der da aller Welt vorgeführt wird.) Das Land ist weiterhin mit das ärmste der Welt und eine quasi international überwachte große Mohnplantage und damit Rohstofflieferant für die Drogenproduktion der Welt. Kosovo, das mit Krieg unter deutscher Beteiligung und am Beginn mit typischen Kriegslügen („Hufeisnenplan“, „Massaker von Račak“) geschaffene europäische Protektorat, ist eine einzige Katastrophe.
Nein, Deutschland ist keine Friedensmacht in der Welt und war es nie. Wir sollten uns raushalten aus den Händeln der Welt und zu Hause gute Politik machen und ein nachahmenswertes Vorbild sein.
Wenn deutsche Berufspolitiker sagen, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt tragen, meinen sie immer, sie müssten mehr Macht bekommen, um sich überall einmischen zu können und überall als bedeutende Mitspieler gefragt zu sein. Irgendeinen Beweis, dass Deutschland irgendwie mit militärischem Eingreifen zum Frieden und Wohlstand beigetragen hat, wird nicht angetreten.
Aus Niels Annens Beitrag ist nur der Wille zur Macht erkennbar – aber nichts für das Volk oder den Weltfrieden.
Kann man mit dem Hinweis auf den IS jetzt eigentlich die gesamte Außenpolitik militarisieren? Ist es wirklich die richtige Grund – Folge –Beziehung: IS oder Boko Haram sind die Teufel, die aus dem nichts kommen und sind ein Ausdruck grundloser Gewalt? Müssen sie mit den eigenen Mitteln bekämpft werden? Oder ist zu analysieren, wieso diese gewalttätigen Ideologien einerseits entstanden sind und andererseits Anhänger finden? Schützen wir uns wirklich selbst, wenn wir überall in der Welt eingreifen? Werden die Aussichten auf Frieden und unsere Sicherheit wirklich erhöht, wenn z.B. in Syrien nicht nur die USA, Russland, Frankreich, England, Australien sondern auch noch demnächst Japan und Deutschland Bomben werfen? Liegen die Ursachen für diesen Rückfall in mittelalterliche Schreckensherrschaften wirklich nur an ein paar bösen Menschen, die man halt mit Bomben und Drohnen ausrotten muss – und dann ist ja alles gut und man kann weiter machen wie bisher?
Nein, wenn Deutschland einfach beim militärischen Spiel der Großmächte mitmacht, verspielt es Lösungskompetenzen. Nur als neutrale Macht, die beweist, dass man sein Militär nur zur Selbstverteidigung bei einem unmittelbaren Angriff einsetzt und dabei besser lebt als die imperialen Großmächte, kann es den Gewalt Predigern bei Rebellen und in Regierung(spartei)en die Glaubwürdigkeit entziehen und wird vielleicht als Friedensvermittler gerufen und akzeptiert werden.
Aber Ironie beiseite, ich muss die imperialistische, neokolonialistische Stimmung, die glaubt, Deutschland sei berufen, die Welt auch mit Gewalt zu ordnen und eine Weltregierung via UNO oder Bündnis herzustellen, bei einigen Mitdiskutanten zur Kenntnis nehmen.
Da sie weder bezogen auf die Erfahrungen mit militarisierter Außenpolitik noch auf das Wohl der Menschen in Deutschland argumentieren, sondern nur Statements abgeben, muss ich schlussfolgern, dass sie angelehnt an Wilhelm II und den „Deutsche Flottenverein“ denken „Von heute an ist das Deutsche Reich eine Weltmacht!“ (1896): Deutschland ist Großmacht und muss Weltpolitik betreiben.
Die Folgen militarisierten Außenpolitik sind eigentlich bekannt. Selbst wenn Deutschland dieses Mal im Verein mit den Westmächten die heutigen Herero- und Maji-Maji - Aufstände niederschlägt und sich an der Unterdrückung solcher wie der Buren beteiligt, und Japan auf Seiten der USA gegen China kämpfen sollte: Rüstung verarmt die Menschen und die Kriege wurden nicht nur für die unterlegenen Völker und Mächte Katastrophen, sondern auch für die europäischen Sieger und die Toten und Versehrten, wie immer sie (posthum) geehrt wurden. Bei einer Neuauflage im Weltmaßstab gälte das auch in dieser Dimension.
Und die Behauptung, ich hätte keine Lösung, ist so abwegig wie die Behauptung, jemand hätte „eine Lösung“. Wer das für die vielen Konflikte auf der Welt von sich behauptet, ist ein Ideologe. Aber Vorstellungen habe ich für viele Situationen schon. Nur sind wir hier nicht diejenigen, die dazu aufgefordert werden, die einleitenden Artikel zu schreiben, wo man sie anbieten kann.
Aber das wird mir alles jetzt zu allgemein, Glaubensfragen der Personen. Das klärt keine Sache und führt nicht zu guter Politik.