Die deutsche Außenpolitik kreist um die Überwindung der europäischen Finanzkrise, die Strukturanpassungsmaßnahmen in Griechenland, die Krise in der Ukraine und den wachsenden Migrationsdruck. Doch es ist falsch, sich hier allzu sehr auf die Binnensicht zu konzentrieren. Denn die größten Verschiebungen finden jenseits europäischer Grenzen statt. Aufstrebende Regionalmächte stehen für ein neues autoritäres Modell und einen anderen – einen gesteuerten –Kapitalismus, den sie mit einigem Erfolg betreiben. Die Welt wird neu vermessen, ob Europa das will oder nicht. Sieben Argumente für eine Außenpolitik jenseits europäischer Grenzen:
Erstens: Voraussetzung für eine gestaltende europäische und auch deutsche Politik ist ein stabiles und prosperierendes Europa. Aber eine deutsche Macht-der-Mitte-Politik würde falsche Signale an die USA und auch an China und Indien senden. So interessant Herfried Münklers Ansatz der Macht der Mitte auch ist, er ist zutiefst eurozentrisch und kreist um sich selbst und um geostrategische Szenarien.
Wenn die Politik Münklers Ansinnen folgen würde, würde aus einem „zögerlichen Hegemon“ Deutschland mutmaßlich eine Macht der Mitte und ein europäischer Hegemon. Das aber wäre ein folgenreicher Fehler. Deutschland sollte nicht zum Hegemon mutieren, darf und sollte sich nicht mehr um die eigene geostrategisch fundierte Achse drehen und die Welt aus einem Blickwinkel des Gestaltens in der näheren Umgebung betrachten. Das politische Abenteuer um die Ecke findet nicht mehr in Brüssel, Istanbul, Kairo, Rabat und Spitzbergen statt, sondern in Peking, Delhi, dem Sahel, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Südasien und Südostasien und in der Antarktis. In diesen Regionen wirken andere Transformationsprozesse, andere Konzepte, andere Wahrnehmungen. Es geht darum, diese zu studieren und zu prüfen, um aufbauend darauf eine antizipative Außenpolitik zu betreiben. Wir müssen lernen, Möglichkeiten mit ihnen auszutarieren, damit wir gemeinsame „Lernkurven“ entwickeln können. Nur so wird ein multilaterales System funktionieren.
Zweitens: Die transatlantische Kooperation ist wichtig. Hier sollte die deutsche und europäische Politik mehr Profil gewinnen, zumal die USA sich nicht gerade in einem relativen Aufstieg befinden – wie im Übrigen auch die EU nicht. Die USA bleiben Partner der EU, aber der Partner ist ein schwächelnder Hegemon, dem die EU ein ganz anderes Profil entgegensetzen muss und kann, um sich als Zivilmacht zu etablieren. Die Hinwendung der USA zum Pazifik trägt den globalen Machtverschiebungen Rechnung. Hier zeigt die US-amerikanische Regierung auch mehr Profil. Aber die EU weist in dieser Hinsicht gravierende Schwachstellen auf, trotz der strategischen Partnerschaften mit China und Indien. Die EU schwächelt vor allem militärisch und sicherheitspolitisch. In Militäreinsätzen ist die EU auf die USA beziehungsweise die NATO angewiesen.
Das Konzept der Gestaltungsmacht Deutschland sollte, drittens, weiterverfolgt werden. Sollte Abschied genommen werden von verstärkter Kooperation mit den Regional Powers, so wäre dies im Grunde genommen eine Steilvorlage für die großen Akteure China und Indien, die sich von den strategischen Partnerschaften mit Deutschland mehr erwartet haben. Grundlegend gilt es, nach neuen Formaten der Kooperation zu suchen und die Kooperation weiter auszubauen, um gemeinsam zur Bewältigung globaler Herausforderungen beizutragen. Sich in Lauerstellung zu begeben ist der falsche Weg. Schließlich nehmen die Regional Powers in allen brennenden Fragen der Weltpolitik letztendlich eine zentrale Rolle ein.
Mit einem Zivilmachtkonzept kann Deutschland ein attraktives Gegenmodell zu Dominanz- und Hegemoniekonzepten etablieren.
Viertens: In vielen globalen Fragen ist das UN-System von größter Bedeutung. Deutschland sollte nicht nachlassen, das UN-System zu unterstützen. Im Gegenteil. Über die UN können zentrifugale Kraftbewegungen mit eingehegt werden. Das ist und bleibt eine zentrale Aufgabe europäischer und deutscher Politik.
Wie sollte, fünftens, deutsche Politik mit autoritären Regimen umgehen? Bislang pflegt Deutschland mit den meisten großen autoritären Ländern wie etwa China, Iran und Russland durchaus enge Beziehungen, während auf kleinere autoritäre Länder weniger Rücksicht genommen wird. Die Erfahrungen der Kooperation mit China, Äthiopien, Vietnam u.a. Staaten zeigen, dass ein zivilmachtorientiertes und demokratisches Land durchaus Möglichkeiten hat, Demokratie, Partizipation und Rechtssicherheit zu fördern und über Entwicklungskooperation und NGOs für eine offenere Gesellschaft zu werben. Hierfür braucht man ein klares Konzept, Durchhaltevermögen und Konfliktbereitschaft.
Sechstens, sollte sich Deutschland die Frage stellen, mit welchen Partnern Allianzen gebildet werden sollten. Es gibt bislang kaum eine Diskussion, welche Rolle die Zusammenarbeit mit den BRICS einnehmen soll. Zwar gibt es zunehmend Kooperationen mit ihnen und auch Konflikte, aber inwieweit die BRICS als Gruppe Adressat deutscher Politik werden soll, bleibt offen. Wichtig wäre es auszuloten, wie die Kooperation mit demokratischen Mittelmächten ausgestaltet werden kann, um global gemeinsam im Sinne eines Zivilmachtkonzepts zu agieren. Die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Mittelmächten, also Ländern, die wirtschaftlich wachsen, sich technologisch entwickeln und global eine ähnliche Rolle wie Deutschland einnehmen, könnte für viele internationale Verhandlungen genutzt werden. Zu den Mittelmächten gehören bspw. Staaten wie Australien, Neuseeland, Kanada, Indonesien, Kolumbien, aber auch Argentinien, die Türkei, Südafrika, Chile, Malaysia und Nigeria. In der Kooperation mit den Mittelmächten geht es nicht um einen Dritten Weg. Mit den Mittelmächten könnte das Zivilmachtkonzept weiter entwickelt werden anstatt von ihm abzuweichen. Das heißt es geht nicht um Transformationsallianzen mit Regional Powers per se sondern um eine Kooperation mit demokratischen Mittelmächten, die bereit sind, an globalen Lösungen mitzuwirken.
Siebtens: Wie kann Deutschland eine neue Entwicklungsagenda befördern? Hauptziele müssen der Ausgleich zu Niedrigeinkommensländern und Beiträge im Kampf gegen Armut sein, die sich mit den Konzepten von struktureller Transformation verbinden. Wie kann deutsche Politik ein Kooperationskonzept mit Afrika gestalten, das sich von dem Geber-Nehmer-Prinzip bzw. der asymmetrischen Kooperation verabschiedet? Notwendig wären neue Konzepte, technologische Kooperation, industrielle Zusammenarbeit, Forschungsverbünde. Die neue Handelskooperation mit Afrika verdeutlicht, dass sich die Asymmetrien wieder verstärken und dass die Kooperation mit Afrika durch zahlreiche grundlegende Probleme erschwert wird, die von afrikanischen Ländern seit langem kritisiert werden, ohne dass die EU zur Lösung beigetragen hat. Auch Deutschland stand in den Handelsberatungen des EPA (Economic Partnership Agreements) am Rande und überließ Lobbygruppen und Protektionisten in der EU das Feld. Zu den Problemen zählen: Europäische Agrarsubventionen, Zugang von afrikanischen Produkten zum europäischen Markt, Fischereipolitik, gravierende Klimaprobleme, Nachhaltigkeit und Rohstoffausbeutung.
Die deutsche Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik sollte sich vor allem auf die demokratischen und weniger korrupten Länder konzentrieren, d.h. auch Farbe gegenüber autoritären Regimen zeigen. Angesichts der großen Herausforderungen sollte das BMZ – wie schon vorher das Auswärtige Amt –eine offene Diskussion zur Zukunft der deutschen und auch europäischen Entwicklungszusammenarbeit in die Wege leiten.
Deutschland ist in der Lage, global eine größere Rolle einzunehmen. Für die deutsche Politik besteht die vornehmliche Aufgabe darin, nicht erneut in die Falle der Geopolitik und in eine hegemoniale Rolle zu tappen. Nur unter der Ägide der UN sollten Deutschland und die EU militärisch eingreifen. Deutschland als Wirtschaftsmacht hat während der letzten Jahrzehnte eine erfolgreiche geoökonomische Strategie verfolgt, die auf einem Zivilmachtkonzept basierte. Die deutsche Macht in Europa ist gewachsen. Auch das Ansehen Deutschlands in der Welt ist gestiegen. Deutschland bietet ein attraktives Modell. Deutsche Politik sollte deshalb gemeinsam mit den Mittelmächten in globale öffentliche Güter investieren. Mit einem Zivilmachtkonzept, das eine neue Entwicklungspolitik des Ausgleichs und der Armutsbekämpfung und der verstärkten Kooperation mit demokratischen Mittelmächten beinhaltet, kann Deutschland ein attraktives Gegenmodell zu Dominanz- und Hegemoniekonzepten etablieren.


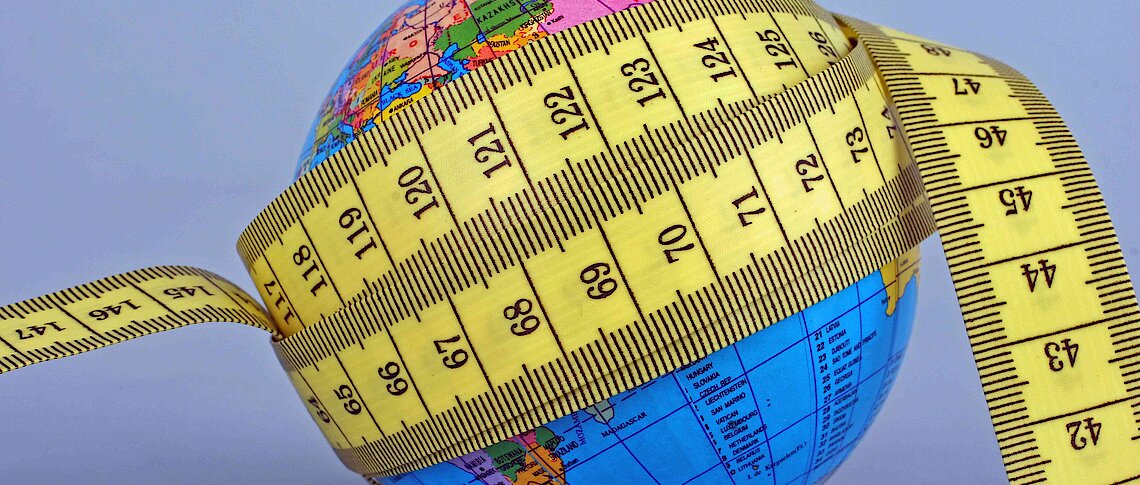




5 Leserbriefe
"Deutschland als Wirtschaftsmacht hat während der letzten Jahrzehnte eine erfolgreiche geoökonomische Strategie verfolgt, die auf einem Zivilmachtkonzept basierte."
Leider wird hier übersehen, daß Deutschland mit seinen Leistungsbilanzüberschüssen für europäische und globale wirtschaftliche Ungleichgewichte gesorgt hat, die zu massenhafter Verarmung und Migration geführt haben. Ein Zivilmachtkonzept, das auf einer falschen wirtschaftlichen (und arbeitsmarktpolitischen) Philosophie beruht, kann genau so grausam sein wie militärische Intervention. Ein Überdenken der deutschen und europäischen Agrarpolitik z.B. (Unterbietungswettbewerb um jeden Preis) ist hier dringend erforderlich.
Mich irritiert der Begriff Nation (gegenüber Region - wobei ich, aufgewachsen als Halb-Holländer, ja sowieso Schwierigkeiten habe). Die Lebensumstände und Zugehörigkeit, aber auch die sachbezogenen Lösungen sind und werden durch internationale Zusammenhänge - und das sind mindestens europäische - geprägt. Die absolute Schwäche sehe in der EU - und dies betrifft auch die wirtschaftlichen Kenndaten und geringen Wachstumsaussichten, wenn man mal von Deutschland auf das Ganze sehen würde. Die Austeritätspolitik hat Europa schwer geschadet und die Wirtschaftspolitik hat eine Art Schlussverkauf gefördert - und eben nicht investiert.
Bezogen auf das Bundeskabinett: Alle Minister sind gleichzeitig "Aussenminister", dies gilt insbesondere auch für Gesellschaftspolitik - die insbesondere freilich von ihrem additivem Charakter und Hilfelösungen zu einem gestaltenden Ansatz finden muss. So wird in diesem übergreifenden Zusammenhängen noch deutlicher, dass wir eine präventive, dh. zielorientierte, planerische (und damit über kurzfristige in Legislaturperioden, wirksame, messbare) Politik brauchen. Entwicklung ist zwingend nur gemeinsam möglich.
Es ist ein subtiler, aber wesentlicher Unterschied: Ja, die Rolle der USA wandelt sich. Geopolitik wird ungleich komplexer und vielfältiger. Auch an der Spitze der Pyramide ist man Teil vom Ganzen, bei weitem kein absoluter Herrscher. Aber es wäre ein grober Fehler daraus zu schlussfolgern, dass die Macht von globalen Hierarchien, wie wir sie seit 250 Jahren beobachten können, in irgendeiner Weise davon betroffen sein wird. Das Matthäus Prinzip bleibt erhalten. Europa muss eine selbstbewusste, innovative und eigenständige Rolle finden, in Anerkennung der wirtschaftlichen Tatbestände ist sie unterhalb des Hegemons (in der gängigen Rhetorik: im Rahmen der westlichen Wertegemeinschaft).
"Die deutsche Macht in Europa ist gewachsen. Auch das Ansehen Deutschlands in der Welt ist gestiegen. Deutschland bietet ein attraktives Modell. Deutsche Politik sollte deshalb gemeinsam mit den Mittelmächten in globale öffentliche Güter investieren. Mit einem Zivilmachtkonzept, das eine neue Entwicklungspolitik des Ausgleichs und der Armutsbekämpfung und der verstärkten Kooperation mit demokratischen Mittelmächten beinhaltet, kann Deutschland ein attraktives Gegenmodell zu Dominanz- und Hegemoniekonzepten etablieren."
Hier ist die Chance, die Perspektive. Daran könnte und sollte man sich orientieren. Und gar nicht zögern sondern gleich beherzt loslegen ...
Und im Endeffekte ist Macht das Potential, seine Wahrnehmung durchzusetzen und Ziele zu erreichen. Eine geopolitische Währung kann so und so genutzt werden. Bei aller (sehr) berechtigter Kritik der USA: die Welt ist ein besserer Ort mit unvergleichbar mehr Wohlstand als im brüchigen Gleichgewicht der europäischen Großmächte vor dem zweiten Weltkrieg. Im Moment gibt es keine Alternative zu einer globalen Ordnungsmacht und wird es in den kommenden Jahrzehnten auch nicht geben (können).
Die EU ist mit ihrem Instrument des nachbarschaftlichen Dialoges und der Positionierung als weiche Macht gnadenlos gescheitert, verweilt immer noch auf der Wirtschaftsleistung von 2007 und kämpft mit Systemkrisen, die bis ins Fundament reichen. Vielleicht wäre es gut, dass man aus der Geschichte lernt und weiß, was nicht funktioniert: Deutschland kann Akzente setzen, innovative Konzepte vorschlagen, sich einbringen und eine sehr positive Rolle spielen, aber nicht als Gegenmodell. Das wäre eine Sackgasse und ein Weg sich zu isolieren.